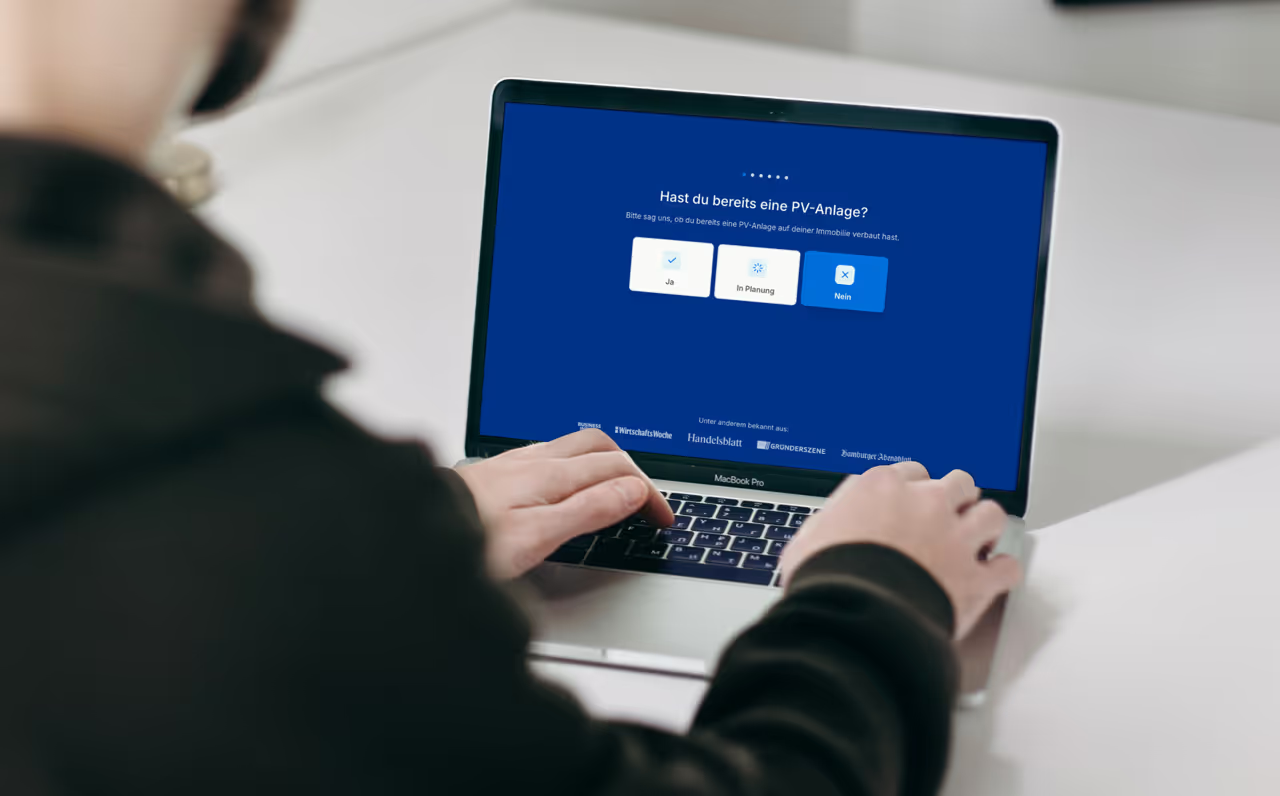Zurück zur Übersicht
Mieterstrommodelle im Überblick: Rentable, grüne Energie für Mehrfamilienhäuser
Veröffentlicht
27.3.2025
Aktualisiert
18.8.2025
Autor
Louisa Knoll
.avif)
Während ländliche Gebiete oft durch große Windparks und Solarfelder zur Energiewende beitragen, stehen urbane Räume vor spezifischen Herausforderungen. Mehr als 58 % der Haushalte in Deutschland leben in Mietwohnungen, viele davon in Mehrfamilienhäusern. Diese ungenutzten Dachflächen bieten ein enormes Potenzial für die lokale Stromerzeugung. Mieterstrommodelle ermöglichen es, diese Flächen effizient zu nutzen und somit die Energiewende auch in städtischen Gebieten voranzutreiben. Allerdings sind solche Projekte häufig mit bürokratischen Hürden und komplexen Anforderungen verbunden. Hier setzt metergrid an: Mit unserer All-in-One-Lösung vereinfachen wir die Umsetzung von Mieterstromprojekten, steigern die Effizienz und unterstützen bei jedem Schritt – auch dank unseres starken Partnernetzwerks.
1. Das klassische Mieterstrommodell: Direkte Stromlieferung an Mieter
Beim klassischen Mieterstrommodell wird der vor Ort erzeugte Strom direkt an die Mieter geliefert und verkauft. Der Anlagenbetreiber, bei diesem Modell ist das in der Regel der Vermieter, übernimmt die Rolle des Stromlieferanten und schließt mit den Mietern entsprechende Verträge ab. Diese Verträge umfassen sowohl den lokal erzeugten Solarstrom als auch den zusätzlich benötigten Reststrom, der vom öffentlichen Netz bezogen wird. Ein zentraler Anreiz für Vermieter ist der Mieterstromzuschlag, eine finanzielle Förderung, die für den vor Ort erzeugten und direkt an die Mieter gelieferten Solarstrom gewährt wird. Dieser Zuschlag variiert je nach Anlagengröße, kann sich verändern und soll die Wirtschaftlichkeit von Mieterstromprojekten erhöhen. Für Mieter bietet dieses Modell den Vorteil, dass sie von günstigeren Strompreisen profitieren können. Das klassische Mieterstrommodell kann mit weiteren Anlagen kombiniert werden, z.B. einem Batteriespeicher, Kraft-Wärme-Kopplung oder einer Wärmepumpe.
Mieterstrom plus Speicher: Integration von Batteriespeichern
Der Einsatz von Batteriespeichern in Mieterstromprojekten ermöglicht es, überschüssigen Solarstrom zu speichern und bei Bedarf, beispielsweise in den Abendstunden oder an bewölkten Tagen, zu nutzen. Tagsüber, wenn die Photovoltaikanlage mehr Strom produziert als verbraucht wird, kann der Überschuss in den Speicher geleitet werden. In Zeiten ohne ausreichende Sonneneinstrahlung wird der gespeicherte Strom genutzt, wodurch der Eigenverbrauchsanteil steigt und die Abhängigkeit vom öffentlichen Netz reduziert wird.
Wirtschaftlich sinnvoll ist die optimale Speichergröße, die sich nach dem Energieverbrauch der Mieter richtet - es wird empfohlen, Speicher nicht zu klein zu dimensionieren. Zudem gibt es regionale Förderprogramme für Batteriespeicher, die in die Planung einbezogen werden sollten.
Mieterstrom mit Wärmepumpe
Eine besonders effiziente Kombination stellt Mieterstrom mit Wärmepumpen dar. Hierbei wird der lokal erzeugte Solarstrom genutzt, um eine Wärmepumpe zu betreiben, die Wärme für Heizung und Warmwasser bereitstellt.
Vorteile von Mieterstrom mit Wärmepumpe:
- Reduzierte Heizkosten für Mieter, da die Wärmepumpe im Idealfall mit günstigem Solarstrom betrieben wird.
- Überschussnutzung für z.B. Pufferspeicher, Erwärmung und Warmwassererwärmung.
- CO₂-Reduktion durch die Vermeidung fossiler Brennstoffe wie Gas oder Öl.
- Möglichkeit zur Kälteerzeugung im Sommer durch Umkehrbetrieb der Wärmepumpe (bei reversiblen Modellen).
Durch den intelligenten Betrieb der Wärmepumpe kann der Eigenverbrauch maximiert werden. So kann sie beispielsweise mittags betrieben werden, wenn die PV-Anlage die höchste Stromproduktion hat und Wärme in einem Warmwasserspeicher für die Abend- und Nachtstunden gespeichert wird.
Diese Kombination wird zunehmend attraktiver, insbesondere mit der steigenden Elektrifizierung des Wärmesektors und dem Rückgang fossiler Heizsysteme.
Kombination mit Kraft-Wärme-Kopplung
Neben Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen kann Mieterstrom auch mit Blockheizkraftwerken (BHKW) realisiert werden, die auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) basieren. Ein BHKW erzeugt gleichzeitig elektrische Energie und nutzbare Wärme, wodurch ein besonders hoher Wirkungsgrad erreicht wird.
Wie funktioniert Mieterstrom mit KWK?
- Ein BHKW wird als zentrale Strom- und Wärmequelle für das Gebäude betrieben.
- Die elektrische Energie wird an die Mieter geliefert und kann mit Strom aus einer PV-Anlage ergänzt werden.
- Die entstehende Wärme wird für die Beheizung des Gebäudes und die Warmwasserbereitung genutzt.
Vorteile von Mieterstrom mit KWK
- Höhere Energieeffizienz: Ein BHKW nutzt die eingesetzte Energie besser als konventionelle Heizsysteme, da sowohl Strom als auch Wärme erzeugt wird.
- Reduzierung der CO₂-Emissionen, insbesondere wenn das BHKW mit Biogas oder Wasserstoff betrieben wird.
- Mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz, da der lokal produzierte Strom direkt genutzt werden kann.
Aber:
- BHKWs bieten viele Vorteile, werden aber zunehmend durch Wärmepumpen ersetzt – vor allem in Neubauten und bei Sanierungen. Ein Grund dafür ist der Gasbedarf der Anlagen, denn auch mit Biogas steigen die Betriebskosten perspektivisch.
2. Varianten der technischen Umsetzung: Physische und virtuelle Modelle im Mieterstrom
Für Mieterstromprojekte gibt es zwei Messkonzepte: das physische Summenzählermodell und das virtuelle Summenzählermodell, die seit Mai 2023 durch das GNDEW (Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende) im EnWG gleichgestellt sind. Dadurch lassen sich Mieterstromprojekte flexibler umsetzen, insbesondere in Bestandsgebäuden.
Physisches Summenzählermodell
Beim physischen Summenzählermodell misst ein Summenzähler den Gesamtstromverbrauch des Gebäudes. Einzelne Wohnungszähler erfassen den Verbrauch der Mieter, während ein zusätzlicher Erzeugungszähler die Strommenge der PV-Anlage oder eines BHKW dokumentiert. Der lokal erzeugte Strom wird direkt innerhalb des Gebäudes genutzt, bevor überschüssiger Strom ins Netz eingespeist oder zusätzlicher Strom aus dem Netz bezogen wird.
Dieses Modell ermöglicht eine präzise Messung und hohe Eigenverbrauchsquoten, erfordert aber oft aufwendige Umbauten an der Zählerinfrastruktur, insbesondere wenn ein Gebäude zuvor nicht für Mieterstrom ausgelegt war.
Virtuelles Summenzählermodell
Das virtuelle Summenzählermodell funktioniert anders: Statt eines physischen Summenzählers werden mehrere individuelle Messlokationen rechnerisch zu einer gemeinsamen Marktlokation zusammengefasst. Dadurch kann die Summe des Netzbezugs aller Mieterstromteilnehmer ermittelt und dem Anlagenbetreiber in Rechnung gestellt werden. Gleichmaßen dient dieser Wert zur Berechnung des Autarkiegrads, welcher maßgebend für die Verteilung von Netz- und PV-Strom je Teilnehmer ist.
Technisch ist dies nur möglich, wenn alle Verbrauchswerte in Echtzeit oder in kurzen Intervallen – etwa alle 15 Minuten – erfasst und übermittelt werden. Dies setzt den Einsatz intelligenter Messsysteme (iMSys) oder registrierender Lastgangzähler (RLM-Zähler) voraus.
Ein großer Vorteil dieses Modells ist, dass es in der Regel deutlich weniger bauliche Veränderungen an der bestehenden Zählerstruktur erfordert als das physische Summenzählermodell. Insbesondere entfällt die Notwendigkeit eines Wandlerschranks oder Wandlermessplatzes, was das virtuelle Modell besonders für Bestandsgebäude attraktiv macht, dort würde der Einbau eines solchen Schranks häufig mit hohem baulichem und finanziellem Aufwand einhergehen.
Allerdings erfordert das virtuelle Summenzählermodell den Einsatz intelligenter Messsysteme. Diese sind mit zusätzlichen Kosten verbunden, und auch die Umsetzung durch die jeweiligen Verteilnetzbetreiber (VNBs) stellt aktuell noch eine Herausforderung dar.
→ Unterschiede im Überblick:
Wir von metergrid bieten grundsätzlich beide technischen Umsetzungsvarianten an - sowohl das klassische Messkonzept mit physischen Zählern als auch das virtuelle Modell. Gerade Letzteres erfordert jedoch im Vorfeld eine enge Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber, da hier besondere Anforderungen an die Datenverarbeitung und Messinfrastruktur bestehen. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich mit einer sorgfältigen Planung auch komplexe virtuelle Konzepte erfolgreich realisieren lassen.
Doch nicht nur bei der technischen Umsetzung stehen wir unseren Kunden beratend zur Seite: Wir begleiten auch unterschiedlichste Betreiberkonstellationen. Unser Ziel ist es immer, ein individuell passendes Konzept zu entwickeln, das sowohl technisch als auch wirtschaftlich überzeugt.
3. Dachpachtmodell: Kooperation mit Energieversorgern
Beim Dachpachtmodell wird die Mieterstromversorgung nicht vom Gebäudeeigentümer selbst organisiert, sondern ein externer Energieversorger übernimmt die Planung, Installation und den Betrieb der Photovoltaikanlage. Der Gebäudeeigentümer stellt dem Energieversorger die Dachfläche zur Verfügung und erhält im Gegenzug eine Pachtzahlung. Die Mieter beziehen den erzeugten Strom direkt vom Energieversorger, der als Stromlieferant auftritt.
Dieses Modell ist besonders für Eigentümer attraktiv, die zwar erneuerbare Energien auf ihrem Gebäude nutzen möchten, aber den betrieblichen und administrativen Aufwand einer eigenen Mieterstromversorgung vermeiden wollen.
→ Die Pachthöhe hängt von Standort, Netzgebühren und Refinanzierungsmöglichkeiten ab und wird individuell mit dem Betreiber ausgehandelt. Vertragliche Details variieren stark, da es keine einheitliche gesetzliche Regelung gibt.
4. Mieterstrom durch Genossenschaften und Bürgerenergie
Neben kommerziellen Energieversorgern können auch Energiegenossenschaften oder Bürgerenergiegesellschaften Mieterstromprojekte umsetzen. Dieses Modell setzt auf gemeinschaftliches Engagement, indem Mieter, Eigentümer und weitere Akteure sich zusammenschließen, um eine Photovoltaikanlage zu finanzieren und zu betreiben.
Wie funktioniert Mieterstrom mit Genossenschaften?
- Gründung oder Beitritt zu einer Energiegenossenschaft: Bewohner oder andere interessierte Bürger können Anteile an der Genossenschaft erwerben und so Teilhaber am Mieterstromprojekt werden.
- Finanzierung der PV-Anlage: Die Genossenschaft sammelt das notwendige Kapital durch Mitgliedsbeiträge oder Kredite.
- Betrieb der Anlage: Die PV-Anlage wird auf einem Mehrfamilienhaus installiert und versorgt die Mieter direkt mit Strom.
- Gewinnausschüttung an Mitglieder: Überschüsse aus der Stromerzeugung oder Einspeisevergütung können an die Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet werden.
Bürgerenergie als Alternative
Bürgerenergiegesellschaften funktionieren ähnlich, sind jedoch oft offener für externe Investoren und haben meist eine breitere Mitgliederstruktur als klassische Energiegenossenschaften. Ziel ist es, die lokale Wertschöpfung zu fördern und möglichst viele Menschen an der Energiewende zu beteiligen.
Vorteile von Genossenschaftsmodellen
- Demokratische Kontrolle: Alle Mitglieder haben Mitspracherecht und profitieren gleichermaßen von den Erträgen.
- Günstige Strompreise: Da die Genossenschaft keinen Gewinn für externe Investoren erwirtschaften muss, kann der Strompreis fair kalkuliert werden.
- Stärkung der regionalen Energiewende: Der vor Ort erzeugte Strom bleibt in der Region, statt durch externe Energieanbieter vermarktet zu werden.
- Unterstützung durch Fördermittel: Es gibt verschiedene KfW-Förderprogramme, die Genossenschaftsmodelle finanziell unterstützen.
- Finanzielle Beteiligung der Mieter: Wer Anteile besitzt, kann nicht nur günstigeren Strom beziehen, sondern auch von Ausschüttungen profitieren.
5. Wettbewerbliche vs. grundzuständige Messstellenbetreiber
Für den Betrieb von Stromzählern gibt es zwei Optionen: den grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB) und den wettbewerblichen Messstellenbetreiber (wMSB). Der Messstellenbetrieb ist ein entscheidender Faktor für die Umsetzung von Mieterstromprojekten, da er bestimmt, wie Strom gemessen, abgerechnet und verwaltet wird.
Der gMSB ist in der Regel der örtliche Netzbetreiber und übernimmt den Einbau, Betrieb und die Wartung der Messstellen. Seine Preise sind gesetzlich reguliert und unterliegen einer festen Obergrenze.
Der wMSB ist ein unabhängiges Unternehmen, das dieselben Aufgaben wie der grundzuständige Messstellenbetreiber übernimmt, jedoch flexiblere Preis- und Leistungspakete anbieten kann. In Kombination mit dem virtuellen Summenzählermodell (vSZ) kann so insbesondere in Bestandsgebäuden auf bauliche Maßnahmen wie den Einbau eines Wandlerschranks verzichtet werden.
Zwar sind intelligente Messsysteme mit höheren Kosten verbunden, ermöglichen aber eine moderne, digitale Messinfrastruktur. Zusätzliche Services wie Verbrauchsvisualisierung oder individuelle Abrechnungen werden dabei nicht vom Messsystem selbst, sondern durch metergrid bereitgestellt.
Individuelle Mieterstromlösungen mit metergrid
Es gibt viele verschiedene Mieterstrommodelle, und die richtige Lösung hängt von Faktoren wie der Gebäudestruktur, den vorhandenen Zählern oder den wirtschaftlichen Zielen ab.
metergrid ist darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Mieterstromlösungen zu entwickeln. Unsere Experten prüfen jedes Projekt individuell und finden die beste Umsetzung – egal ob mit physischem oder virtuellem Summenzählermodell, ob als Eigenprojekt, in Zusammenarbeit mit Energieversorgern oder in Kooperation mit Genossenschaften. Gerade Bürgerenergie- und Genossenschaftsmodelle gewinnen an Bedeutung, da sie Mieter aktiv in die Energiewende einbinden und eine gemeinschaftliche Finanzierung ermöglichen.
Mit unserem Rendite Radar können wir die Wirtschaftlichkeit eines Mieterstromprojekts im Voraus berechnen. So wird schnell sichtbar, ob sich das Modell lohnt und welche Variante die besten Vorteile bietet.
Ob Neubau oder Bestandsgebäude, Dachpachtmodell oder gemeinschaftliches Genossenschaftsprojekt, mit oder ohne Batteriespeicher – metergrid sorgt dafür, dass jedes Mieterstromprojekt optimal umgesetzt wird. Jetzt dein Mieterstromprojekt bei metergrid einreichen!
Häufige Fragen:
Welche Mieterstrommodelle gibt es – und für wen eignen sie sich?

Grundsätzlich gibt es vier gängige Modelle:
- Klassisches Mieterstrommodell (Vermieter als Stromlieferant)
- Dachpachtmodell (externer Energieversorger nutzt die Dachfläche)
- Genossenschaftsmodell (Bewohner betreiben die PV-Anlage gemeinschaftlich)
- Bürgerenergie-Projekte (breitere Beteiligung durch externe Akteure)
Welches Modell passt, hängt von Zielen, Beteiligungswunsch und Ressourcen des Eigentümers ab.
Was ist der Unterschied zwischen physischem und virtuellem Summenzählermodell?

Beim physischen Modell wird der Stromfluss direkt mit einem Summenzähler erfasst – oft mit baulichem Mehraufwand.Das virtuelle Modell (vSZ) erfasst Messwerte digital über intelligente Zähler und fasst sie rechnerisch zusammen. Es ist besonders in Bestandsgebäuden attraktiv, da keine baulichen Eingriffe in die Zählerinfrastruktur nötig sind – vorausgesetzt, der Netzbetreiber stimmt zu.
Wie kann Mieterstrom mit Batteriespeicher oder Wärmepumpe kombiniert werden?

Batteriespeicher ermöglichen es, überschüssigen Solarstrom zu speichern und zeitversetzt zu nutzen – ideal für Abendstunden. Wärmepumpen nutzen Solarstrom zur Wärmegewinnung und reduzieren fossile Heizkosten. Beide Technologien erhöhen den Eigenverbrauch und steigern die Wirtschaftlichkeit des Projekts.
Was leisten Genossenschaften oder Bürgerenergiegesellschaften bei Mieterstromprojekten?

Sie ermöglichen es Mietern und Bürger:innen, sich aktiv finanziell und organisatorisch an der Energiewende zu beteiligen. Die PV-Anlage wird gemeinschaftlich geplant, finanziert und betrieben. Der erzeugte Strom bleibt in der Region, die Kosten sind meist fair kalkuliert – mit demokratischer Kontrolle und möglicher Gewinnausschüttung.
Welche Rolle spielen Messstellenbetreiber bei Mieterstrom?

Der Messstellenbetreiber bestimmt, wie Strom erfasst und abgerechnet wird. Neben dem grundzuständigen Betreiber (Netzbetreiber) kann ein wettbewerblicher Messstellenbetreiber gewählt werden, z. B. für das virtuelle Modell. Er ermöglicht moderne, digitale Messung – meist flexibler, individueller und oft wirtschaftlicher.