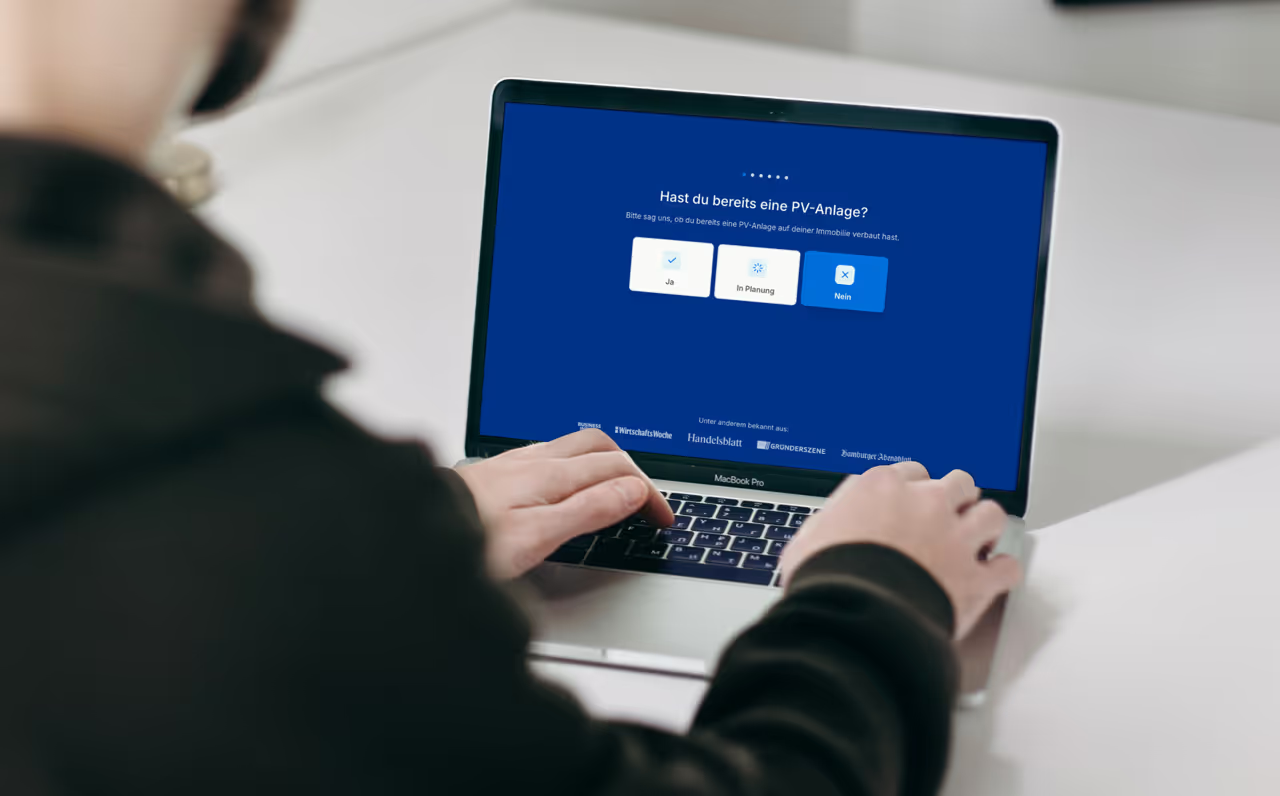Zurück zur Übersicht
Netzüberlastung und Blackout? Nicht mit Mieterstrom!
Veröffentlicht
1.4.2025
Aktualisiert
18.8.2025
Autor
Louisa Knoll

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein zentraler Baustein der deutschen Energiewende. Besonders Photovoltaik erlebt einen starken Zuwachs, was jedoch neue Herausforderungen für die bestehende Netzinfrastruktur mit sich bringt. In Spitzenzeiten kann es zu einer Überproduktion von Solarstrom kommen, die das Stromnetz an seine Belastungsgrenzen führt. Solche Netzüberlastungen können Spannungsschwankungen und Frequenzinstabilitäten verursachen und im schlimmsten Fall zu Stromausfällen führen. Um dem entgegenzuwirken, sind Netzbetreiber manchmal gezwungen, erneuerbare Energieanlagen vorübergehend aus dem Netz zu nehmen “abzuregeln”, was bedeutet, dass potenziell nutzbare saubere Energie ungenutzt bleibt.
Ziel sollte allerdings sein, weniger wertvollen grünen Strom zu vergeuden und die Bedingungen so zu verbessern, dass dieser Strom besser genutzt, gesteuert und integriert werden kann. Neben dem dringend notwendigen Netzausbau gewinnen daher auch dezentrale, steuerbare Lösungen an Bedeutung – allen voran der Mieterstrom.
Was passiert bei Netzüberlastung – und was ist eigentlich ein Blackout?
Damit unser Stromnetz stabil bleibt, muss jederzeit ein Gleichgewicht zwischen Einspeisung und Verbrauch herrschen. Wird dieses Gleichgewicht gestört, etwa durch zu hohe Einspeisung oder zu viel gleichzeitigen Verbrauch, greifen zunächst automatische Sicherheitsmechanismen. Sie stabilisieren das Netz kurzfristig – doch bei extremen Schwankungen kann es im worst-case zu Ausfällen kommen.
Ein Blackout ist ein großflächiger und länger anhaltender Stromausfall. Er kann große Teile des Landes betreffen und hat gravierende Auswirkungen auf Haushalte, Unternehmen und die öffentliche Infrastruktur. Ursache sind meist Extremwetterereignisse, aber auch technische Überlastung ist ein potenzieller Auslöser.
Daneben gibt es lokal begrenzte, kurzfristige Stromausfälle, wie sie etwa durch Bauarbeiten oder Störungen im Niederspannungsnetz verursacht werden. Diese dauern in der Regel nur Minuten bis wenige Stunden.
Wie wahrscheinlich ist ein Blackout in Deutschland?
Deutschland verfügt über eines der sichersten Stromnetze weltweit. Laut Bundesnetzagentur lag die durchschnittliche Stromunterbrechung pro Haushalt 2023 bei unter 13 Minuten – ein Spitzenwert im internationalen Vergleich. Ein flächendeckender Blackout bleibt daher unwahrscheinlich, kann jedoch in Extremszenarien nicht vollständig ausgeschlossen werden. Analysen zeigen, dass unter extremen Bedingungen, wie unerwartet hohen Lastspitzen oder unvorhergesehenen Ausfällen, das Risiko für Versorgungsengpässe steigt. Insbesondere durch die zunehmende Elektrifizierung in Bereichen wie Mobilität und Heizung steigt die Bedeutung von Strom – und mit ihr die Anforderungen an ein stabiles Versorgungssystem.
Verschiedene Lösungen für ein stabiles Netz
Um die Versorgungssicherheit auch bei weiterem Ausbau der erneuerbaren Energien zu gewährleisten, braucht es ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen:
- Netzausbau und -verstärkung: Die physische Infrastruktur muss so angepasst werden, dass sie größere Mengen Strom transportieren kann – regional wie überregional.
- Gesetzgeberische Maßnahmen, wie das Solarstromspitzengesetz, fördern eine netzorientierte Einspeisung.
- Energiespeicher helfen, überschüssigen Strom zu zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt bereitzustellen.
- Digitale Steuerung und Flexibilisierung: Intelligente Netze, steuerbare Anlagen und moderne Energiemanagementsysteme entlasten das System.
- Und dezentrale Modelle wie Mieterstrom tragen dazu bei, Strom direkt vor Ort zu verbrauchen – ohne Umweg über das öffentliche Netz.

Mieterstrom: Lokale Energie mit vielen Vorteilen
Besonders in Ballungsräumen kann es zu Lastspitzen und Überlastungen kommen. Eine vielversprechende Möglichkeit, die Netzbelastung zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu erhöhen, bietet das Mieterstrommodell: Hierbei wird Solarstrom direkt auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses erzeugt und ohne Umweg über das öffentliche Netz an die Mieter verteilt. Diese dezentrale Form der Energieversorgung kombiniert doppelte Flächennutzung, Klimaschutz und Netzentlastung – und macht Mieterstrom so zu einem zentralen Baustein der urbanen Energiewende.

So funktioniert Mieterstrom
Das Prinzip einfach erklärt: Der Immobilienbesitzer – häufig auch der Vermieter – installiert eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Immobilie und verkauft den dort erzeugten Strom im Rahmen von Mieterstromverträgen an seine Mieter. Diese Belieferung umfasst in der Regel sowohl den lokal erzeugten PV-Strom als auch den ergänzenden Reststrombezug aus dem Netz.
Durch den direkten Verbrauch vor Ort wird deutlich weniger Strom in das öffentliche Netz eingespeist oder über lange Strecken transportiert – was die Netze entlastet und die Energie effizienter nutzbar macht. Mieter profitieren dabei nicht nur von günstigeren Stromkosten und sinkenden Nebenkosten, sondern auch von einem aktiven Beitrag zur Energiewende. Vermieter wiederum können attraktive Renditen erzielen – und steigern gleichzeitig den Wert ihrer Immobilie durch moderne, nachhaltige Technik.
Tipp: Mieterstrom ist vielseitig umsetzbar – nicht nur durch Eigentümer selbst. Auch Energiegenossenschaften oder Bürgerenergiegesellschaften können Mieterstromprojekte realisieren. Mehr dazu in unserem Artikel: Mieterstrommodelle im Überblick.
Mieterstrom - noch effizienter mit Batteriespeicher
Besonders wirkungsvoll wird Mieterstrom in Kombination mit Batteriespeichern. Diese ermöglichen es, überschüssigen Solarstrom zwischenzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt – etwa in den Abendstunden – wieder nutzbar zu machen. So wird der Eigenverbrauchsanteil maximiert und der Bedarf an Netzstrom noch weiter gesenkt. Das erhöht nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Projekts, sondern sorgt auch für eine effizientere Energieversorgung im Gebäude. Mehr über Mieterstrom in Kombination mit Batteriespeichern erfährst du in unserem Blogbeitrag "Mieterstrom mit Stromspeichern".
Energiewende für alle – auch für Bewohner von Mehrfamilienhäusern
Ein entscheidender Vorteil: Mieterstrom öffnet die Tür zur Energiewende auch für die über 50 % der Menschen in Deutschland, die zur Miete wohnen. Während PV-Anlagen bisher fast ausschließlich ein Privileg von Eigenheimbesitzer waren, schafft das Mieterstrommodell soziale Teilhabe an der dezentralen Energiezukunft.
metergrid – Mieterstrom einfach, effizient und digital
Trotz der vielen Vorteile gilt Mieterstrom oft als kompliziert und voller bürokratischer Hürden – und schreckt so noch immer viele Immobilienbesitzer ab. Doch genau hier setzt metergrid an: Mit digitalen Lösungen, einem erfahrenen Partnernetzwerk und einem Fokus auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit machen wir Mieterstrom einfach umsetzbar und greifbar.
Dass das Modell funktioniert, haben wir als Mieterstrom-Vorreiter bereits vielfach bewiesen: Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir tausende Projekte erfolgreich umgesetzt. Auf unserer Website erfährst du spannende Details über unsere Referenzprojekte.
Du möchtest wissen, ob sich Mieterstrom auch bei deinem Gebäude lohnt? Unsere kostenlose Wirtschaftlichkeitsberechnung mit dem Rendite Radar zeigt dir, welches Potenzial in deinem Projekt steckt – angepasst auf deine individuellen Anforderungen. Kontaktiere uns unverbindlich für eine erste Einschätzung durch unsere Experten: Jetzt Kontakt aufnehmen.
Häufige Fragen:
Warum kommt es überhaupt zu Netzüberlastungen bei Solarstrom?

Weil Photovoltaikanlagen in Spitzenzeiten – z. B. an sonnigen Mittagen – mehr Strom erzeugen, als lokal verbraucht oder über das bestehende Netz transportiert werden kann. Das kann Spannungsschwankungen und sogar Stromausfälle verursachen. In solchen Fällen müssen Netzbetreiber Anlagen abregeln – und wertvoller grüner Strom bleibt ungenutzt.
Was ist ein Blackout und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland?

Ein Blackout ist ein großflächiger, länger andauernder Stromausfall. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering – 2023 lag die durchschnittliche Stromunterbrechung bei unter 13 Minuten pro Haushalt. Dennoch steigt das Risiko punktueller Überlastung durch den starken Zuwachs an PV-Anlagen und elektrifizierten Anwendungen (Wärmepumpen, E-Mobilität).
Wie hilft Mieterstrom, das Stromnetz zu entlasten?

Mieterstrom nutzt lokal erzeugten Solarstrom direkt vor Ort – ohne Umweg über das öffentliche Netz. Das reduziert den Netzdurchsatz, vermeidet Transportverluste und entlastet besonders Ballungsräume bei Lastspitzen. Gleichzeitig profitieren Mieter von günstigem Strom, und Vermieter von attraktiven Renditen.
Welche Rolle spielen Batteriespeicher im Mieterstrommodell?

Batteriespeicher steigern die Effizienz, indem sie Solarstrom zwischenspeichern und zeitversetzt bereitstellen – etwa abends, wenn die Sonne nicht scheint. So wird der Eigenverbrauch maximiert, die Einspeisung ins Netz reduziert und die Wirtschaftlichkeit des Projekts erhöht. Ein wichtiger Hebel für Netzstabilität und Autarkie.
Für wen ist Mieterstrom besonders interessant – und wie gelingt der Einstieg?

Für Immobilienbesitzer, Vermieter, Genossenschaften und Projektentwickler – insbesondere in städtischen Mehrfamilienhäusern. Mit Lösungen wie von metergrid lässt sich Mieterstrom heute einfach, digital und rechtssicher umsetzen. Ein erster Schritt: die kostenlose Wirtschaftlichkeitsberechnung mit dem Rendite Radar.