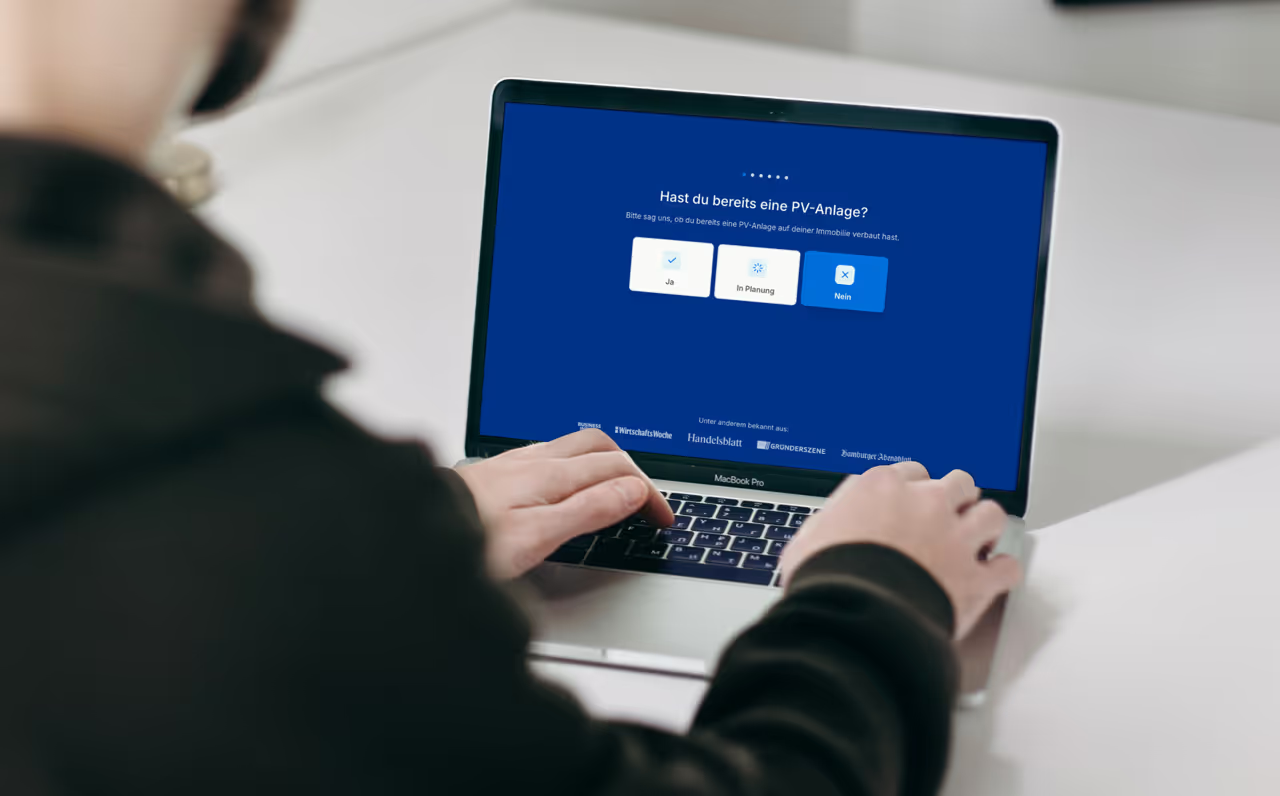Zurück zur Übersicht
Solarspitzengesetz 2025: PV-Regelungen und Auswirkungen auf Mieterstrom
Veröffentlicht
4.4.2025
Aktualisiert
18.8.2025
Autor
Louisa Knoll

Übersicht: Was ist das Solarspitzen-Gesetz und warum ist es notwendig?
Am 25. Februar 2025 trat das “Solarspitzen-Gesetz”, was sich hauptsächlich auf Änderungen im EEG bezieht, in Kraft. Es wurde eingeführt, um temporäre Überschüsse in der Solarstromerzeugung zu glätten und damit einer politisch drohenden PV-Ausbaubremse entgegenzuwirken. Dies ist entscheidend, um die langfristigen Ausbauziele der Energiewende realisieren zu können. Besonders betroffen von den Gesetzesänderungen sind Gebäude-PV-Anlagen, bei denen der gewonnenen Strom in das öffentliche Netz eingespeist wird. Gleichzeitig eröffnet es neue Chancen für Betreiber, die auf Eigenverbrauch, intelligente Vernetzung und Energiespeicher setzen.
Die zentralen Ziele des Gesetzes sind:
- Vermeidung von Netzüberlastungen durch eine Reduzierung von Solarspitzen.
- Flexiblere und wirtschaftlichere Nutzung von PV-Strom durch den Einsatz von Batteriespeichern.
- Förderung der Eigenverbrauchsmodelle, z.B. Mieterstrom.
- Erhöhung der Netzstabilität, um das Argument einer „Netzüberlastung“ nicht als politisches Hindernis für den weiteren PV-Ausbau zu nutzen.
- Förderung der Digitalisierung und beschleunigter Smart-Meter-Rollout.
Besonders wichtig sind die folgenden Änderungen:
- PV-Anlagen müssen steuerbarer werden → Pflicht zur Fernsteuerbarkeit und Einspeisemanagement.
- Vergütung wird angepasst → Förderzahlungen entfallen bei negativen Strompreisen, werden aber nachgeholt.
- Batteriespeicher können flexibler genutzt werden → Das Zwischenspeichern mit Netzstrom wird erleichtert.
- Bestandsanlagen können freiwillig wechseln → Wer auf die neue Regelung umsteigt, erhält 0,6 ct/kWh mehr.
- Netzbetreiber dürfen eingreifen → Wenn Steuerungspflichten nicht erfüllt werden, kann eine Anlage abgeschaltet werden.
Für bestehende PV-Anlagen gilt (Inbetriebnahme vor dem 25.02.2025):
- Keine rückwirkenden Änderungen: Die Einspeisevergütung und bestehenden Regelungen bleiben unverändert.
- Smart Meter und Steuerbox: Eine Nachrüstung ist nicht verpflichtend, kann jedoch Vorteile bieten, wie den Zugang zu dynamischen Stromtarifen und zeitvariablen Netzentgelten.
- Freiwillige Anpassung: Betreiber können freiwillig auf das neue Modell umsteigen.
Das FAQ sowie das Merkblatt des Bundesverbands Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) bieten eine übersichtliche Zusammenfassung der kommenden Änderungen und erläutern die praktischen Auswirkungen des Gesetzes. Im Folgenden werden wir die wichtigsten Aspekte für PV-Anlagenbetreiber und Mieterstrommodell-Teilnehmer genauer erläutern.
1. Einspeisevergütung: Anpassung bei negativen Strompreisen
Mit der neuen Regelung des § 51 EEG entfällt die Einspeisevergütung für PV-Anlagen, sobald die Strompreise an der Börse ins Negative rutschen. Das bedeutet, dass Anlagenbetreiber in solchen Momenten keine Vergütung für den eingespeisten Strom erhalten. Allerdings gibt es eine Kompensation: Die entgangene Förderung wird nach Ablauf des gesetzlichen Vergütungszeitraums nachgeholt. Die Berechnung dieser Nachzahlung basiert auf dem durchschnittlichen solaren Ertragspotential der betroffenen Monate.
Für PV-Anlagen bis 100 kWp mit Inbetriebnahme nach Inkrafttreten des Gesetzes gilt eine Übergangsfrist: Die Regelung greift erst ab dem Jahr nach der Installation eines intelligenten Messsystems (iMSys). Kleinanlagen unter 2 kWp, wie Balkonkraftwerke, bleiben von dieser Regelung befreit – es sei denn, die Bundesnetzagentur trifft eine anderslautende Festlegung.
→ Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagement helfen, negative Strompreise zu umgehen, indem der Strom vor Ort gespeichert oder direkt verbraucht wird.
→ Betreiber von Bestandsanlagen können freiwillig in das neue System wechseln: In diesem Fall erhalten sie eine Vergütungserhöhung von 0,6 ct/kWh. Voraussetzung: Verzicht auf die Einspeisevergütung in Zeiten negativer Strompreise. Dieses Angebot könnte für viele Betreiber attraktiv sein, insbesondere wenn sie durch intelligente Energiemanagementsysteme eine höhere Eigenverbrauchsquote erreichen können.
2. Einspeiseleistungsbegrenzung auf 60 % für neue PV-Anlagen
Eine weitere bedeutende Änderung betrifft die maximale Einspeiseleistung von PV-Anlagen, die eine Einspeisevergütung oder einen Mieterstromzuschlag erhalten.
Künftig gilt:
- Neuanlagen unter 25 kWp dürfen nur noch 60 % ihrer maximalen Leistung ins Netz einspeisen.
- Anlagen zwischen 25 kW und 100 kW müssen bei einer Direktvermarktung fernsteuerbar sein.
- Falls diese Anlagen eine Einspeisevergütung oder einen Mieterstromzuschlag erhalten, müssen sie zusätzlich die 60 %-Einspeisebegrenzung umsetzen.
→ Diese Begrenzungen gelten nur, wenn noch kein intelligentes Messsystem (iMSys) installiert ist. Ab einer Anlagengröße von 7 kW ist der Einbau eines iMSys allerdings verpflichtend. Ist die Anlage mit einem iMSys und einer geeigneten Steuerungseinrichtung ausgestattet und wurde die Fernsteuerbarkeit vom Netzbetreiber erfolgreich getestet, entfallen die genannten Einschränkungen.
Ausnahmen:
- Stecker-Solar-Geräte sind von dieser Regelung ausgenommen.
- Diese Begrenzung betrifft nur die Einspeiseleistung, nicht die gesamte Erzeugung.
- Betreiber können also weiterhin den erzeugten Strom speichern oder selbst verbrauchen.
Auswirkungen auf Endverbraucher und PV-Anlagenbetreiber
Simulationen zeigen, dass die Begrenzung der Einspeiseleistung auf 60 % je nach Ausrichtung der PV-Anlage unterschiedlich starke Auswirkungen hat:
- Südausgerichtete Anlagen: Abregelungsverluste von bis zu 9 % möglich.
- West-Ost-ausgerichtete Anlagen: Verluste deutlich geringer, nur etwa 1,1 %.
Diese Verluste treten jedoch hauptsächlich bei Südanlagen ohne Speicher auf, die ihren gesamten Strom ins Netz einspeisen. In der Praxis ist das selten der Fall, da mittlerweile die meisten neuen Anlagen mit einem Batteriespeicher ausgestattet werden. Das BSW-Solar geht davon aus, dass dies dazu beiträgt, den Eigenverbrauch zu maximieren und Einspeiseverluste zu vermeiden.
Wichtige Punkte für Endverbraucher:
- Kaum Nachteile mit Speicher – Wer seinen Solarstrom speichert, kann ihn direkt vor Ort nutzen, statt ihn ins Netz einzuspeisen.
- Gezieltes Laden zur Mittagszeit – Ein Speicher sollte so gesteuert werden, dass er besonders dann lädt, wenn die PV-Anlage viel Strom produziert und der Verbrauch im Haus gering ist.
- Speicherkapazität nicht zu klein wählen – Ein ausreichend großer Speicher hilft, Überschüsse sinnvoll zu nutzen und Verluste zu minimieren.
Für Betreiber von Südanlagen ohne Speicher kann die Einspeisebegrenzung größere Auswirkungen haben. Wer hingegen auf intelligente Steuerung und Speicherlösungen setzt, kann die neuen Regelungen nahezu ohne Nachteile umsetzen.
3. Beschleunigter Rollout von intelligenten Messsystemen (iMSys)
Der Ausbau intelligenter Messsysteme (iMSys) wird deutlich beschleunigt. Bis Ende 2026 sollen 90 % der neu installierten PV-Anlagen, die bis September 2026 installiert wurden, mit einem iMSys und einer Steuerungstechnik ausgestattet sein. Auch Bestandsanlagen müssen nach und nach aufgerüstet werden.
Die Priorisierung der Nachrüstung erfolgt durch die Netzbetreiber bzw. grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB). Dabei wird festgelegt, welche Anlagen vorrangig mit der neuen Messtechnik ausgestattet werden.
Kann ein iMSys vorzeitig installiert werden?
Ja, eine vorzeitige Installation ist grundsätzlich möglich – insbesondere bei Verbrauchszählern in Nicht-Pflichtfällen. In solchen Fällen kann der Betreiber ein intelligentes Messsystem beantragen, muss dann aber ein „angemessenes Entgelt“ zahlen.
- Der gesetzliche Maximalbetrag beträgt 100 €, jedoch fordern viele Netzbetreiber höhere Beträge.
Bei PV-Anlagen oder Summenzählern im Rahmen der verpflichtenden Ausstattung ist eine vorzeitige Installation in der Regel Teil des geplanten Rollouts und nicht direkt vom Betreiber initiierbar.
- Falls es technische Gründe gibt, kann der Einbau verzögert werden – die Frist von 4 Monaten darf dann verlängert werden.
4. Flexiblerer Betrieb von Batteriespeichern
Mit der neuen Regelung im § 19 EEG wird der Betrieb von Batteriespeichern flexibler. Künftig dürfen Speicher sowohl geförderten Solarstrom als auch Netzstrom speichern und zurückspeisen. Dabei gibt es zwei Betriebsmodelle:
Pauschaloption (für kleine Heimspeicher bis 30 kWp):
- Kein aufwendiges Messkonzept erforderlich.
- Die EEG-geförderte Strommenge wird pauschal mit 500 kWh pro kWp angesetzt.
Abgrenzungsoption (für größere Speicher, z. B. Gewerbeanlagen):
- Erfordert detaillierte Messkonzepte, um Solarstrom und Netzstrom klar voneinander abzugrenzen.
Wichtige Änderungen für Betreiber:
- Speicher in der Direktvermarktung können nun sowohl Solarstrom als auch Netzstrom speichern und rückspeisen.
- Netzbetreiber behalten das Recht, Regeln für die Rückspeisung festzulegen.
- Bestands- und Neuanlagen profitieren gleichermaßen von diesen neuen Flexibilisierungsoptionen.
5. Neue Regelungen für Netzbetreiber
Die Netzbetreiber erhalten neue Möglichkeiten, um Überlastungen im Stromnetz gezielt zu verhindern.
- Flexible Steuerungsmaßnahmen ermöglichen es, dass zeitweise Abschaltungen gezielt erfolgen können.
- Diese Eingriffe sollen dazu beitragen, Spitzenlasten besser zu managen und Netzstabilität zu gewährleisten.
Unter bestimmten Bedingungen dürfen Netzbetreiber eine PV-Anlage vom Netz trennen. Dies ist der Fall, wenn:
- Der Messstellenbetreiber seine Pflichten nicht erfüllt, z. B. wenn kein iMSys eingebaut wurde.
- Der Anlagenbetreiber gegen Steuerungsanforderungen (§ 9 EEG) oder Direktvermarktungspflichten (§ 10b EEG) verstößt.
Bevor es zu einer Abschaltung kommt, muss der Betreiber jedoch eine Nachbesserungsfrist von einem Monat erhalten. Zudem sind Netzbetreiber berechtigt, Vorkehrungen gegen ungewolltes Wiedereinschalten zu treffen.
Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar). (2025). FAQ Solarspitzengesetz.

Auswirkungen auf Mieterstrom und lokalen Solarstromverbrauch
Das Solarspitzengesetz enthält mehrere Regelungen, die für Betreiber von Mieterstromprojekten und für Immobilienbesitzer, die Solarstrom direkt vor Ort nutzen, relevant sind. Dabei geht es vor allem um die Vergütungsstruktur, Steuerbarkeit der Anlagen und die Einspeiseregulierung.
Vorteile für Mieterstromprojekte und lokale Nutzung
Rentabilität bei negativen Strompreisen bleibt erhalten
- Anders als bei Volleinspeiseanlagen bleibt bei Mieterstrommodellen die lokale Direktnutzung weiterhin vollständig wirtschaftlich, da hier kein direkter Verkauf an der Strombörse erfolgt.
- Der Eigenverbrauch durch Mieter oder Bewohner wird nicht von der Regelung zur Aussetzung der Vergütung bei negativen Strompreisen betroffen.
Einspeisebegrenzung auf 60 % hat geringere Auswirkungen
- Bei Mieterstrommodellen wird ein Großteil des Solarstroms direkt vor Ort verbraucht – dadurch fällt die 60 %-Einspeisebegrenzung weniger ins Gewicht. Laut BSW liegen die durchschnittlichen Ertragsverluste bei nur 1,1 %, in Ausnahmefällen bei bis zu 9 %. Selbst bei rund 500 Stunden negativer Strompreise im Jahr (ca. 5,7 % der Zeit) wären die tatsächlichen Verluste meist deutlich geringer.
- Überschüssiger Strom kann zudem gezielt in Batteriespeicher geladen werden, um ihn später zu verbrauchen.
Erleichterungen für Mieterstrom durch schnelleren Rollout intelligenter Messsysteme
- Mieterstrommodelle mit virtuellem Summenzähler (vSZ) könnten vom schnelleren iMSys-Rollout profitieren. Bisher scheiterten viele Projekte an langen Abstimmungen mit den Messstellenbetreibern – das dürfte sich nun ändern.
Speicher können jetzt auch für Netzstrom genutzt werden
- Das Gesetz erleichtert den flexiblen Betrieb von Batteriespeichern – Mieterstromprojekte dürfen nun nicht mehr nur PV-Strom, sondern auch Netzstrom zwischenlagern. So kann günstiger Strom auch abends genutzt werden, wenn keine direkte PV-Erzeugung stattfindet.
- Wirklich effizient wird das jedoch erst in Kombination mit einem Energiemanagementsystem (EMS), das den Strombezug und -einsatz intelligent steuert.
Herausforderungen für Mieterstromprojekte
⚠ Neue Anforderungen an die Steuerbarkeit von Anlagen
- Mieterstromanlagen müssen in Zukunft besser steuerbar sein. Das bedeutet, dass Betreiber darauf achten müssen, dass intelligente Messsysteme und Steuerungseinrichtungen integriert werden.
- Dies betrifft insbesondere Anlagen über 25 kW, die in der Mieterstromförderung oder in der Direktvermarktung sind.
Mieterstrom mit metergrid – Einfach, digital und rentabel
Du möchtest wissen, wie wirtschaftlich ein Mieterstrommodell für dein Gebäude ist? Mit unserem Rendite Radar erhältst du in wenigen Minuten eine präzise Einschätzung zu deiner möglichen Rendite – kostenlos und unverbindlich.
Zudem zeigen unsere Referenzprojekte, dass Mieterstrom nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis ein erfolgreiches, nachhaltiges Geschäftsmodell ist.
Mit unserer Software und dem übersichtlichen Dashboard wird Mieterstrom digitalisiert, vereinfacht und greifbar. Automatisierte Prozesse sorgen für eine transparente Abrechnung und machen die Verwaltung unkompliziert.
Jetzt kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren – wir erklären dir nicht nur dein individuelles Mieterstrompotenzial, sondern besprechen auch gerne die Auswirkungen des Solarspitzengesetzes für dein Projekt: Jetzt beraten lassen!
Häufige Fragen:
Was ist das Solarspitzen-Gesetz und warum wurde es eingeführt?

Das Solarspitzen-Gesetz, in Kraft seit dem 25. Februar 2025, soll kurzfristige Solarstrom-Überschüsse entschärfen, Netzüberlastungen vermeiden und den weiteren PV-Ausbau sichern. Es zielt vor allem auf eine bessere Steuerbarkeit von PV-Anlagen, fördert Eigenverbrauch und Speicherlösungen und beschleunigt den Rollout intelligenter Messsysteme.
Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf Mieterstromprojekte?

Mieterstrom bleibt wirtschaftlich attraktiv – da der lokal erzeugte Strom direkt vor Ort verbraucht wird, greift die Regelung zur gestrichenen Einspeisevergütung bei negativen Börsenstrompreisen nicht. Auch die Einspeisebegrenzung auf 60 % hat bei typischen Mieterstromprojekten nur geringe Auswirkungen, da der Großteil des Stroms ohnehin im Haus bleibt.
Was bedeutet die neue 60 %-Einspeisebegrenzung konkret?

Neue PV-Anlagen bis 25 kWp dürfen maximal 60 % ihrer Nennleistung ins Netz einspeisen – es sei denn, sie sind mit einem intelligenten Messsystem (iMSys) ausgestattet. Für Mieterstromprojekte mit hohem Eigenverbrauch ist diese Begrenzung meist unproblematisch, insbesondere mit West-Ost-Ausrichtung oder zusätzlichem Speicher.
Wie unterstützt das Gesetz den Einsatz von Batteriespeichern?

Speicher dürfen künftig sowohl Solar- als auch Netzstrom aufnehmen und wieder abgeben. Für kleine Speicher reicht ein pauschales Abrechnungsmodell. Das ermöglicht eine höhere Eigenverbrauchsquote, reduziert Einspeiseverluste und macht Mieterstrom flexibler – besonders in Kombination mit einem Energiemanagementsystem (EMS).
Was sollten Betreiber jetzt beachten, um gesetzeskonform zu bleiben?

PV-Anlagen müssen künftig fernsteuerbar und mit iMSys ausgestattet sein – insbesondere bei Förderanspruch oder Direktvermarktung. Netzbetreiber dürfen Anlagen abschalten, wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind. Frühzeitige technische Ausstattung und die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wie metergrid sichern Rechtssicherheit und Projektstabilität.